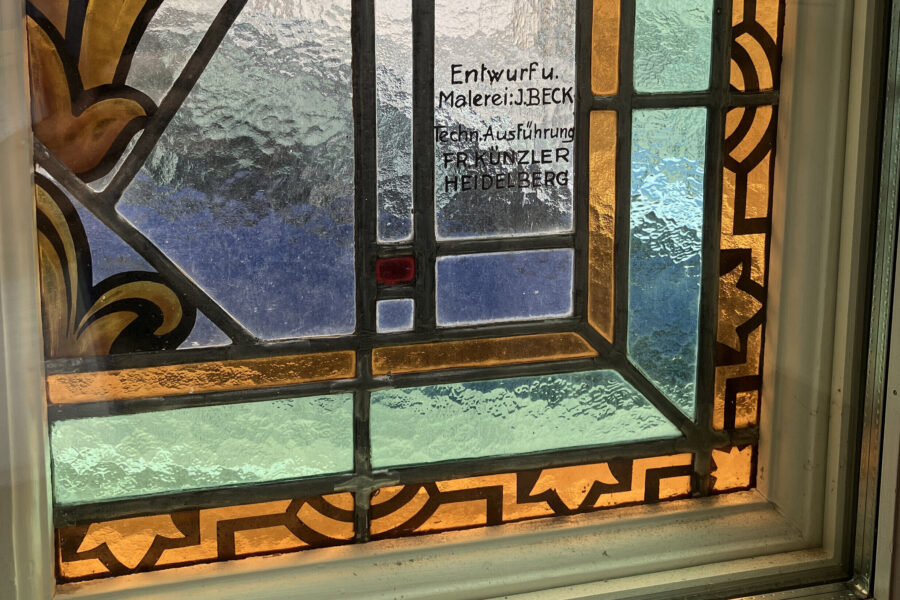Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Fronleichnam: Ein Fest der Farbenpracht

Eine aus Blüten hergestellte Kirche.
dpa/Patrick Seeger)Die liturgische Prachtenfaltung ist ein Kennzeichen des Katholizismus und markiert einen der Unterschiede zur evangelischen Kirche. Besonders deutlich wird das an Fronleichnam, das Luther als Fest rundum ablehnte und auch als „Theater“ bezeichnete. Das Wort „Fronleichnam“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „vrône lîcham“ für „des Herren Leib“ ab. Gefeiert wird an diesem Tag, immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, die bleibende Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie – und das mit Prozessionszügen und vielerorts prächtigem Blumenschmuck, ja kompletten Blumenteppichen am Wegesrand.
Dies ist schön anzuschauen und lockt beispielsweise in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) deshalb jedes Jahr viele auswärtige Besucher an.
Das gemeinsame Schmücken der Straßen und Plätze stiftet und stärkt auch den Zusammenhalt der Gemeinde. Die Bilder aus Blumen stellen oft religiöse Motive, heilige Symbole und Szenen aus der Bibel dar. Sie zu gestalten erfordert große Präzision – und eine Vielzahl von Blumen in unterschiedlichen Farben und Formen.
In Hüfingen reicht die Brauchstradition zurück bis ins Jahr 1842. Damals legte der Bildhauer Franz Xaver Reich, inspiriert von Studienreisen in Süditalien, dort den ersten Blumenteppich. Bald machten das auch seine Nachbarn, schließlich alle Einwohner entlang des Prozessionswegs. „1906 wurde in der Zeitung erstmals über den Hüfinger Brauch berichtet“, heißt es auf dem Internetauftritt der Gemeinde.
Einen „wahren Aufschwung“ gab es demnach nach dem zweiten Weltkrieg. Zu sehen sind unter den figürlichen Darstellungen laut Mitteilung der Stadt „hauptsächlich Szenen aus dem Leben Jesu, die Marienverehrung sowie Engel oder Heilige“.
Zum theologischen Gehalt und kirchenhistorischen Hintergrund: Der Blumenschmuck ist gleichsam als sichtbarer Pfad zu verstehen, auf dem Christus selbst in der Monstranz durch die Straßen schreitet. Die kunstvoll angelegten Teppiche sind also nicht nur dekorativ, sondern bereiten vor allem symbolisch einen heiligen Weg vor, der die Gegenwart Gottes in das Alltägliche holt.
Entstanden ist das Fest im 13. Jahrhundert in Lüttich auf Initiative einer Chorherrin hin, die als Juliana von Lüttich oder Juliana de Cornillon bekannt ist. Das Fest war das erste, das der Papst allgemein für die lateinische Kirche auferlegte.