Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Michael Resch über die Vor- und Nachteile von digitalen Zwillingen für Kommunen

Michael Resch, Direktor des HLRS.
HLRS)STUTTGART. Michael Resch ist der Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums der Uni Stuttgart (HLRS). Dort wird an digitalen Zwillingen, also virtuellen Abbildern, zum Beispiel von Städten, geforscht. Im Interview erklärt er die Vorzüge eines digitalen Zwillings und gibt praxisnahe Beispiele.
Staatsanzeiger: Herr Resch, Sie forschen an digitalen Zwillingen. Was kann man sich unter einem digitalen Zwilling vorstellen?
Michael Resch: Ein digitaler Zwilling ist der Versuch, die Realität, so wie sie ist – Häuser, Straßen, Bäume – im Computer abzubilden, sodass man sie anschauen und Dinge ausprobieren, Simulationen laufen lassen kann. Man nimmt im Prinzip seine Kommune, steckt sie in den Computer und kann sich und ihre Veränderungen anschauen. Dies wird in der Zwischenzeit sehr häufig in der Industrie verwendet: Produkte werden zunächst virtuell erstellt, bevor sie tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist die Grundidee des digitalen Zwillings.

Welche Vorteile können Kommunen haben, wenn sie einen digitalen Zwilling nutzen?
Der Vorteil ist, dass alles, was planerisch zu entscheiden ist – eine Straße, die man bauen will oder eine Einbahnregelung – zunächst im digitalen Zwilling erstellt, sich angeschaut und in verschiedenen Varianten ausprobiert werden kann. Man kann im Computer Dinge ausprobieren, ohne dass man sie in der Realität machen muss. Es wäre zum Beispiel möglich, den Cannstatter Wasen zu simulieren und die Lärmbelastung zu berechnen. Daraufhin könnten Untersuchungen angestellt werden, welche Auswirkungen es auf den Lärm hat, wenn man an bestimmten Orten Lärmschutzwände aufstellt – und das, ohne es in Realität umsetzen zu müssen. Das kann Fehplanungen beim Bauen vermeiden und entsprechend Kosten sparen.
Und die Nachteile?
Der Nachteil ist, dass ein digitaler Zwilling mit gewissen Kosten verbunden ist: Man braucht die Daten und mindestens eine Person, die sich darum kümmert und sich auskennt. Zudem muss bedacht werden, dass die Daten regelmäßig überprüft und aktualisiert werden müssen. Wird zum Beispiel eine Baugenehmigung in der Kommune erteilt, so muss dieses Gebäude im digitalen Zwilling mit gebaut werden.
Wie können Kommunen diese Daten aktuell halten?
Im Planungsbereich braucht es Personen, die über digitale Kompetenzen verfügen und mit geografischen Informationssystemen umgehen können. Diesen Personen muss dafür auch die Zeit gegeben werden. Mit einer kleinen Kommune bis 1000 Einwohner wird das schwierig. Aber in den kleinen Kommunen hat man wahrscheinlich auch nicht die großen Planungsanforderungen.
Daten müssen also immer aktuell sein. Gibt es Ausnahmen?
Das kommt drauf an. Gerade im Bau gibt es das Building-Information-Management, kurz BIM. Das wird zunehmend von Architekten eingesetzt, sodass ein digitaler Zwilling für ein Gebäude entsteht. Der Testturm in Rottweil wurde zum Beispiel als digitaler Zwilling am HLRS untersucht. Wenn das Gebäude einmal gebaut ist, muss es im digitalen Zwilling nicht mehr geändert werden. Dasselbe gilt für die Automobilindustrie, bis es in einer Baureihe ein Upgrade gibt.
Weitere Informationen zu digitalen Zwillingen lesen Sie im Dossier Digitaler Zwilling.
Digitale Zwillinge scheinen vielseitig einsetzbar zu sein.
Ja, einen digitalen Zwilling kann man im Prinzip von allem machen. Sie müssen nur etwas digitalisieren können. Vom Menschen, Fahrzeugen, Maschinen, Gebäuden bis zur ganzen Kommune, ganzen Bundesrepublik, können Sie einen digitalen Zwilling basteln.
Können Sie weitere Beispiele nennen, was kommunal geplant werden kann?
Ich nenne drei Beispiele für Stuttgart. Wenn Sie von Stuttgart 21 einen digitalen Zwilling hätten, dann hätten sie in den intensiven Diskussionen deutlicher zeigen können, wie es aussieht und wie es funktioniert. Da muss der digitale Zwilling natürlich auch korrekt sein. Als zweites Beispiel können Sie mit dem digitalen Zwilling die ganze Verkehrsplanung in Stuttgart optimieren. Es gibt eine Verkehrsleitzentrale in Stuttgart, und es gibt natürlich auch Planungen dazu. Über einen digitalen Zwilling sind solche Planungen aber einfacher zu machen. Das dritte Beispiel ist das Thema Luftqualität. Sie können ein Modell aufbauen, wo Sie laufend eine Vorausberechnung haben, was mit der Luftqualität passiert und können dann versuchen, Steuerungsmaßnahmen einzuleiten.
Was kann man drüber hinaus simulieren?
Sie können versuchen, alles zu simulieren. Das kann ein neues Fahrradnetz sein oder der 1. Mai-Umzug oder auch Routen für Demonstrationen. Bei der Verkehrsplanung zum Beispiel brauchen Sie ein paar Daten: Sie müssen also Messungen über die Verkehrsauslastungen bestimmter Straßen machen. Wenn Sie das gut machen und mit einer Befragung von den Fahrern verbinden, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, wer eigentlich von A nach B will. Wenn Sie dann in der Stadt eine große Baustelle planen, dann können Sie diese im digitalen Zwilling einbauen und schauen, was dann passiert. Und wenn ich weiß, dass 37.000 Fahrzeuge jeden Morgen vom Pragsattel in die Stadt fahren, und Sie aber genau an dieser Stelle eine Baustelle planen, dann sollten Sie sich genau Gedanken über die Verkehrsführung um diese Baustelle herummachen. Voraussetzung für eine gute Planung ist eine Gesamtplanung.
Wie realitätsnah sind diese Simulationen?
Das kommt drauf an. Für die Feinstaubbelastung hat man in der Regel gute Daten, und diese folgen physikalischen Gesetzen – und genau so wird es auch im digitalen Zwilling wiedergegeben. Auch das Wetter kann gut vorhergesagt werden, auf die kommenden zwei Tage im Voraus, sogar auf die Stunde genau. Viel schwieriger wird es, wenn man menschliches Verhalten vorhersagen will. Ein Beispiel ist das Verhalten auf der Autobahn bei Stau. Es gibt Leute, die folgen der Umleitung, und es gibt Leute, die bleiben auf der Autobahn. Doch Sie wissen nicht, wie viele das eine oder das andere tun werden. Dafür haben Sie statistische Daten, die können aber fehleranfällig sein, sobald menschliches Verhalten im Spiel ist.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Bei der Loveparade in Duisburg wurden vorher Simulationen gemacht. Und man hat bei den Simulationen vernünftige Annahmen gemacht. Doch dann war es so, dass eine Gruppe junger Menschen reingegangen ist und gemerkt hat „Mir gefällt das nicht, ich will hier raus“ und zurück zum Eingang wollte. Das Gegen-den-Strom-Laufen führte zu einer Panik. Man kann das Unvorhersehbare nicht vorhersehen. Nun kann man aber davon ausgehen, bei dem, was wir planen – also jemand fährt früh an die Arbeit – nichts Irrationales geschieht. Bei den Daten kann auch variiert werden: Ich kann nicht genau sagen, wie sich die Menschen verhalten werden, aber ich kann sagen, ungefähr in diesem Bereich werden sie es tun.
Kann man Ressourcen sparen mit einem digitalen Zwilling?
Man kann Fehlplanungen vermeiden. Nehmen wir an, ich habe eine Verkehrsplanung und stelle nach drei Jahren fest, dass die völlig schiefgegangen ist, dann fange ich an, dort umzubauen. Und diese Kosten spart man sich mit einem digitalen Zwilling dann.
Lohnt sich so ein Zwilling überhaupt für jede Kommune?
Für eine kleine Kommune, in der alles überschaubar ist, lohnt es sich nicht. Wenn man im Bereich von 1000 Einwohnern ist, geht man lieber zum Ingenieurbüro. Wenn man aber in einer Größenordnung wie Herrenberg ist, lohnt sich das definitiv, weil der Aufwand nicht so hoch ist. Ist man eine Kommune, die ständig Planungsfragen zu bewältigen hat, dann ist ein digitaler Zwilling absolut sinnvoll.

Wenn sich eine Kommune dafür entschieden hat, wie geht sie vor?
Wenn eine Kommune auf uns zukommt, würden wir erstmal mit ihr klären, was an Daten schon vorhanden ist, wie weit die Digitalisierung vorangeschritten ist und dann würde man konkret schauen, was die Kommune möchte: Geht es um ein Projekt, das nur einmalig ist? Ist es etwas Kontinuierliches? Und dann definiert man das Projekt, die Kosten und so weiter.
Der Vorteil bei uns ist, dass wir das Know-How haben und auch über die Rechenleistung verfügen. Denn nicht jede Kommune kann es sich leisten, ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen. Das über uns zu machen, kostet natürlich was, aber die Kosten sind relativ gering. Wenn ich auf einem Prozessor eine Stunde lang rechne, kostet das in Stuttgart 30 Cent. Bei einer relativ einfachen Simulation bewegen wir uns also bei 5 bis 10.000 Euro.
Was kostet das denn nun insgesamt?
Die eigentlichen Kosten liegen in den geografischen Informationssystemen, wo die Daten liegen und im Personal, um einen digitale Planungsprozess voranzutreiben. Bei der Ausschreibung der Stelle sollte man darauf achten, dass Leute eingestellt werden, die mit diesem Thema relativ vertraut sind. Bei den Lizenzkosten ist es schwer, eine Zahl zu nennen. Softwarelizenzen können zwischen 5000 Euro und 5 Millionen Euro liegen, und es kommt ganz darauf an, was sie damit machen wollen.
Welche Projekte verfolgt das HLRS aktuell?
Eines davon geht ums Emergency-Computing, also Notfall-Berechnungen. Hier wollen wir auf Ämter und Behörden zugehen und fragen: „Wo habt ihr eure Daten?“ In der Corona-Pandemie kam das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf uns zu. Sie sagten, sie könnten Vorhersagen zur Belegung der Intensivbetten treffen, doch sie bräuchten unsere Hilfe, da sie keinen großen Rechner hätten. Das haben wir dann gemacht. Bei uns wurden die Vorhersagen der Intensivbettenbelegung für das Innenministerium berechnet.
Es gibt also Notfälle, wie die Pandemie, die Überschwemmung im Ahrtal oder Atomkraftunfälle und Menschen, die auf so etwas reagieren müssen. Doch sie verfügen nicht über einen Supercomputer. Die wissen also, wie es geht, doch nicht, wie es sehr schnell geht, weil deren Systeme um ein Tausendfaches langsamer ist als unseres. Wir wollen nun herausfinden, wo sich diese Organisationen befinden, die für uns im Notfall Entscheidungen treffen müssen und dafür Simulationen brauchen. Mit denen wollen wir ins Gespräch kommen.



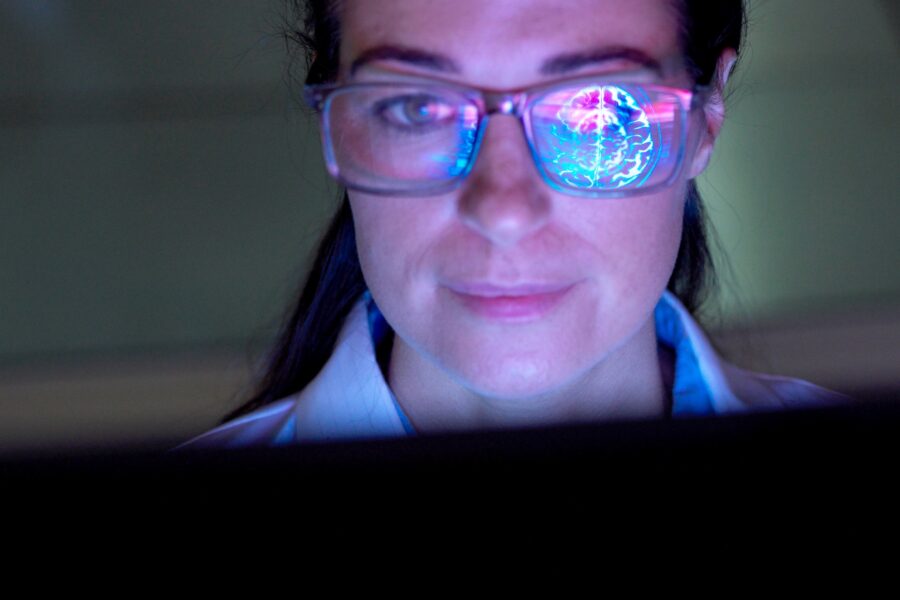

Lesermeinungen
Bitte loggen Sie sich ein, um zu kommentieren.