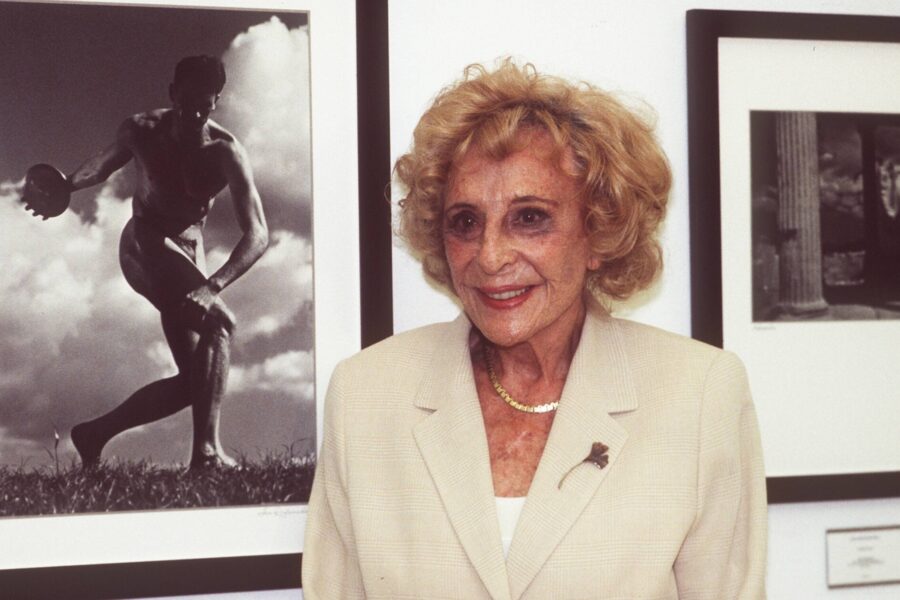Themen des Artikels
Um Themen abonnieren und Artikel speichern zu können, benötigen Sie ein Staatsanzeiger-Abonnement.Meine Account-Präferenzen
Die Politik muss mehr Social Media nutzen

Social Media Icons
Adobe Stock)Stuttgart. Ob Franziska Brantner von den Grünen, Markus Frohnmaier von der AfD oder Kanzleramtsminister Thorsten Frei von der CDU – keiner möchte auf das modernste Werbemittel verzichten, dass das 21. Jahrhundert zu bieten hat: die Sozialen Medien. Plattformen wie Instagram, X oder TikTok haben den Wahlplakaten aus Papier längst den Rang abgelaufen. Doch mit neuen Möglichkeiten kommen Herausforderungen: „Sie müssen heute viel mehr Kommunikationswege bespielen als früher, um die gleiche Anzahl Menschen zu erreichen“, sagt Thorsten Frei. Früher hätten sich die Menschen über eine Lokalzeitung informiert, heute ist die Medienlandschaft vielfältiger.
Algorithmen spielen gezielt Beiträge aus
Zum „Leidwesen klassischer Medien“ haben die Sozialen Medien laut Markus Frohnmaier mittlerweile sogar den höchsten Stellenwert. Der Co-Landesvorsitzende der AfD meint: „Gerade für die Politik ist es wichtig, diesen Trend nicht zu verschlafen.“ Die AfD sei den anderen Parteien dabei voraus: „Wir machen hier sehr viel richtig, während unsere Konkurrenten noch im Schlafwagen sitzen.“
Soziale Medien sind nicht mehr wegzudenken in der Meinungsbildung. Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP, sagt: „Meinung passiert in Sozialen Medien.“ Das ist auch deswegen so, weil intelligente Algorithmen das passende Publikum für die veröffentlichten Inhalte suchen. Sie erkennen die Interessen des Nutzers und spielen dann gezielt Beiträge aus. Politiker müssen sich nicht länger die Frage stellen, wie ihre Werbung den Personenkreis erreicht, der aus potenziellen Wählern besteht.
Die Lösung ist die Künstliche Intelligenz. Grünen-Chefin Franziska Brantner sieht hier jedoch auch ein Problem. Die Algorithmen seien so programmiert, dass Positives nie so viel Reichweite erfährt wie Negatives: „Mit Hass und Hetze läuft es fantastisch. Deswegen ist es für Demokraten auch so schwierig.“ Die Algorithmen seien eine Gefahr für den Diskursraum: „Wenn es sich auszahlt, radikal zu sein, dann radikalisieren sich die Leute auch.“
Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt
Ebenfalls problematisch: Jeder Nutzer kann eigene Beiträge ins Netz stellen. Unabhängig von seiner Meinung, aber auch unabhängig von einem Faktencheck. Brantner fordert an dieser Stelle mehr Qualitätsjournalismus, der diese Beiträge überprüft. Er könnte aufdecken, welches System hinter Deepfakes oder Fehlinformationen steckt. Brantner selbst war zuletzt selbst von der Falschinformation betroffen, sie sei keine deutsche Staatsbürgerin und besitze eine Villa in Kalifornien: „Das Ziel ist, Zweifel darüber zu säen, wer ich tatsächlich bin.“ Ein Faktencheck konnte die Wahrheit ans Licht bringen.
Soziale Medien sind aber nicht nur ein politisches Instrument, sondern greifen auch in das Privatleben der Politiker ein. Brantner: „Wenn mich junge Leute in der Bahn ansprechen, nennen sie mich nicht die Brantner von den Grünen, sondern die Brantner von TikTok.“ Letztlich sind Politiker Menschen, die sich mehr oder weniger im digitalen Rampenlicht wohlfühlen. Judith Skudelny nimmt privat nämlich lieber die Beobachterrolle ein: „Auch wenn die Welt mehr Katzen- und Pferdebilder braucht, behalte ich die lieber für mich (und mein Adressbuch).“